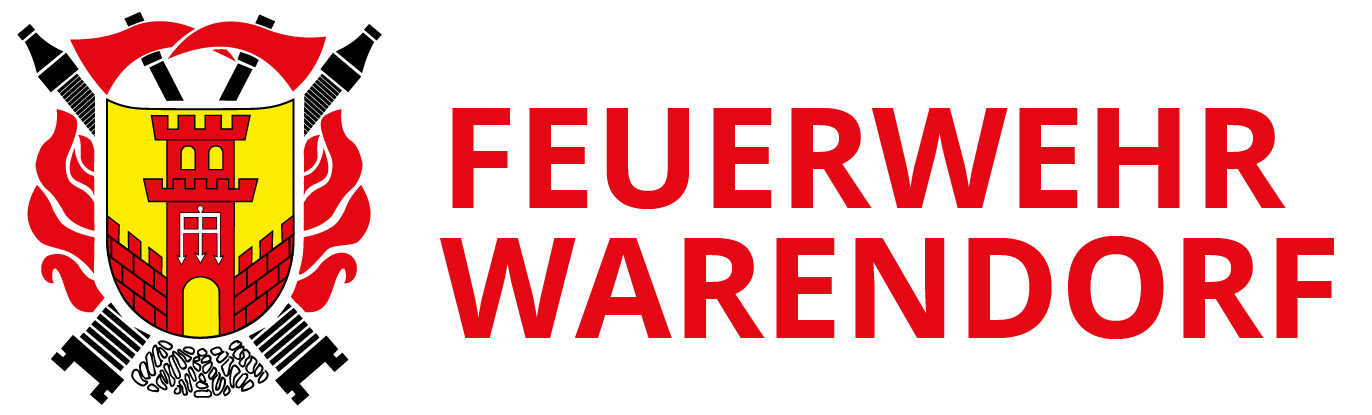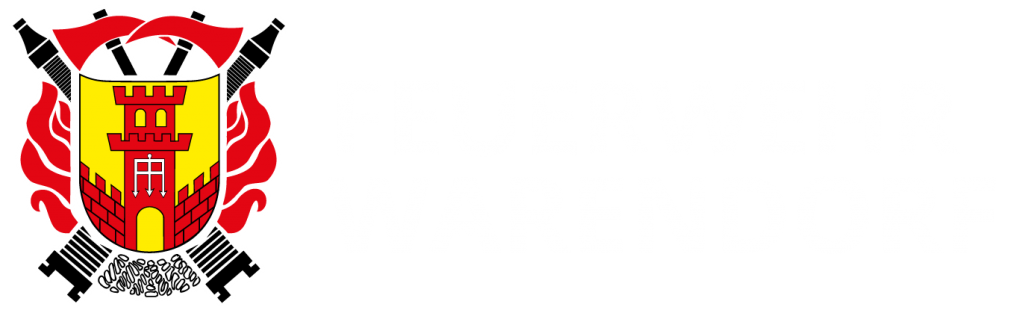Wenn Feuerwehrleute darüber reden wollen, was sie erlebt haben, haben sie mit Martin Kofoth einen Ansprechpartner. Er ist Seelsorger bei der Feuerwehr.
Ein Schnaps und ein Bier, und die Welt ist wieder in Ordnung. Das war lange oft die einzige Form von „Einsatznachbereitung“ bei der Feuerwehr, bevor es diesen Begriff überhaupt gab.
Wer früher schlimme Einsätze mitgemacht hat, in belastenden Situationen war, der trank was. Und bekam obendrauf von den Kameraden einen markigen Spruch, vergiftete Motivation. Heute ist die Realität eine andere, die Mentalität hat sich gewandelt und die Unterstützung der Ehrenamtlichen hat einen großen Schritt gemacht. Auch dank Menschen wie Martin Kofoth. Er ist Seelsorger bei der Feuerwehr, er hilft den Helfern.
Kofoth ist Diakon in der Gemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus. Vorher war er Berufssoldat, im Kosovo im Auslandseinsatz – und zum Ende seiner Bundeswehrkarriere bei der Personalgewinnung in Düsseldorf, ein Job am Schreibtisch. Er pendelte, am Wochenende Freckenhorst, unter der Woche im Rheinland, die Ehe wurde zur Wochenendbeziehung und er hatte viel Zeit nachzudenken. Dann, allein in seiner kleinen Wohnung am Rhein, beschloss Kofoth, in eine ganz andere Richtung zu gehen, ein Fernstudium anzufangen: Theologie.
2011 war seine Weihe als Diakon. Parallel begann er, sich in der Notfallseelsorge zu engagieren, in Düsseldorf und in Freckenhorst. Nach Unfällen, bei Todesfällen war er für die Menschen in Not da, stützte sie, hörte zu. Die Angehörigen, die Opfer – und oft genug diejenigen, die den Unfall verursacht hatten. Aber eine Gruppe war immer da und fehlte doch: die Retter.
Martin Kofoth wandte sich an Bistum und Feuerwehr und erklärte seine Absicht, auf die Menschen in den Uniformen zuzugehen. Die Idee war neu, die Verantwortlichen hatten zumindest nichts dagegen, so nahm er es wahr. Allerdings war er Theologe und Notfallseelsorger, kein Feuerwehrmann. „Retter sprechen eine andere Sprache“, sagt er, „und da fängt die Verarbeitung schon an.“ Anfangs fuhr er mit raus zu den Einsätzen, er redete mit den Kameraden, wenn sie Bedarf hatten. Aber etwas fehlte. „Ich hatte die Feuerwehrpraxis nicht“, erzählt er. Er stand vor der Wahl. Weiter nur zugucken? Oder den Lehrgang machen, die Qualifikation nachholen?
Kofoth entschied sich, „richtiger“ Feuerwehrmann zu werden. „Man bekommt einen anderen Zugang, wenn man gemeinsam geschwitzt hat“, sagt er. Diesen Zugang braucht er, Vertrauen und gemeinsame Erfahrungen sind die Grundlagen seiner Arbeit. Anfangs musste er trotzdem Werbung machen für das, was er tut. Er stellte sich bei den einzelnen Zügen vor, tauchte bei Treffen auf, klebte seinen Flyer ans Schwarze Brett. Darauf seine Telefonnummer und drei Versprechen: Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und die Möglichkeit zu reden, außerhalb der Hierarchie.
Die Kameraden meldeten sich. Nicht alle und nicht gleichzeitig, aber immer wieder, mit ganz unterschiedlichen Anliegen, über die sie sprechen wollten. Über Privates und Berufliches genauso wie über ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Feuerwehr. Kofoth mag den Vergleich mit dem Fass, das sich füllt, bei jedem Menschen. Durch Stress und durch Probleme. Irgendwann kommt noch ein Tropfen dazu, es wird zu viel. Das muss nicht unbedingt im Einsatz passieren.
Drastisch ausgedrückt: „Wenn Blut spritzt, ist das nicht sofort und allein ein Problem“, sagt er. „Es geht darum, dass der Kopf nicht frei ist für die nächste Belastung“. Der Tropfen kann ein Einsatz sein, nachdem es vorher Stress im Privatleben gab. Aber genauso andersherum, private Probleme, die nach oder während eines Einsatzes plötzlich auftauchen und das Fass ein bisschen zu viel füllen. Wenn Kofoth das erklärt, hat es nichts von Therapie, es ist ein Ventil, eine Strategie zur Bewältigung.
Er hat einen Melder am Gürtel und wird über jeden Alarm der Feuerwehr informiert. Ob er raus fährt, entscheidet er selbst, abhängig vom Stichwort, das das Gerät anzeigt. Am Einsatzort ist er erstmal einfach nur da. „Ich schaue in die Gesichter“, sagt Kofoth. Und er achtet auf das Verhalten seiner Kameraden.
„Ich habe immer Traubenzucker in meiner Weste“, sagt Kofoth. Er ist nicht der Trainer, der seine Spieler vom Platz holt, das darf er auch gar nicht. Aber er kann das Tempo rausnehmen und die Bilder, den Film unterbrechen. Einen Raum bieten, der sich sicher anfühlt. Und dann sitzen sie manchmal da, abseits des Geschehens, auf dem Trittbrett des Löschfahrzeugs, unter einem Baum oder in einem Auto ohne Funk. Auch stundenlang.
„Es kostet viel Kraft, nichts zu sagen. Das Schweigen muss man aushalten“, sagt er. Er kann viele Beispiele nennen, gerade hier „auf dem Dorf“, wo die Einsätze plötzlich ganz nah sein können. Wenn die Autos wieder eingerückt sind, geht er mit in die Nachbesprechungen, die ganz anders laufen als früher. Wenn die Uniform abgelegt wird, ist der Einsatz vorbei, so sollte es sein. „Da sitzen 20 Leute und die haben 20 unterschiedliche Filme gesehen von dem, was passiert ist. Diese Feedback-Runden sind dafür da, dass alle denselben Film sehen“, sagt er.
Das klappt nicht immer. Gerüche, Geräusche, Bilder können hängenbleiben. Es müssen keine großen Belastungen sein, die lange nachwirken oder zur Krankheit werden. Es geht um die Momente gerade eben, die länger, aber nicht ganz lange bleiben. Die zwischendurch wiederkommen können. Der Seelsorger kennt Wege, damit umgehen zu lernen.
Quelle: Westfälische Nachrichten